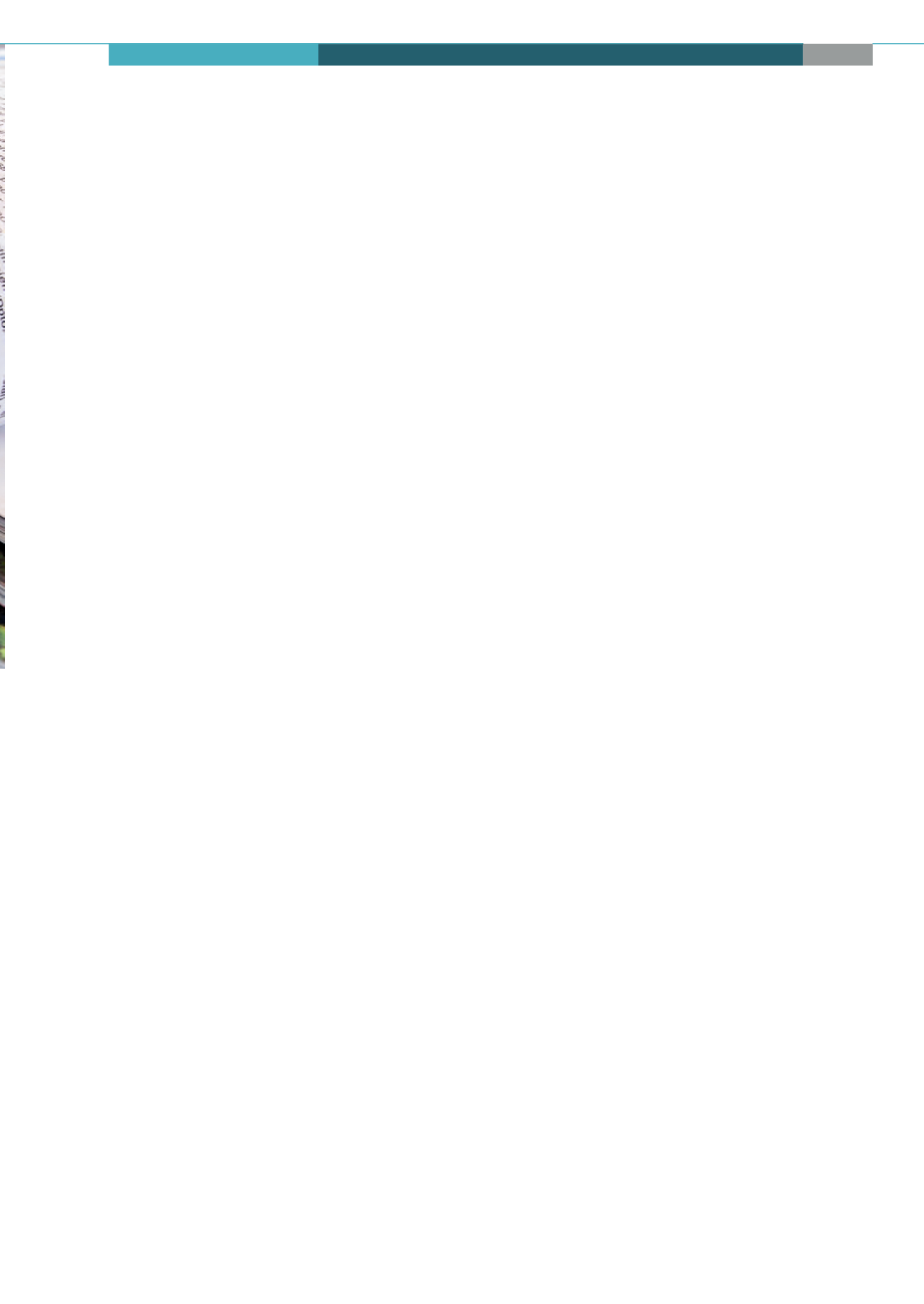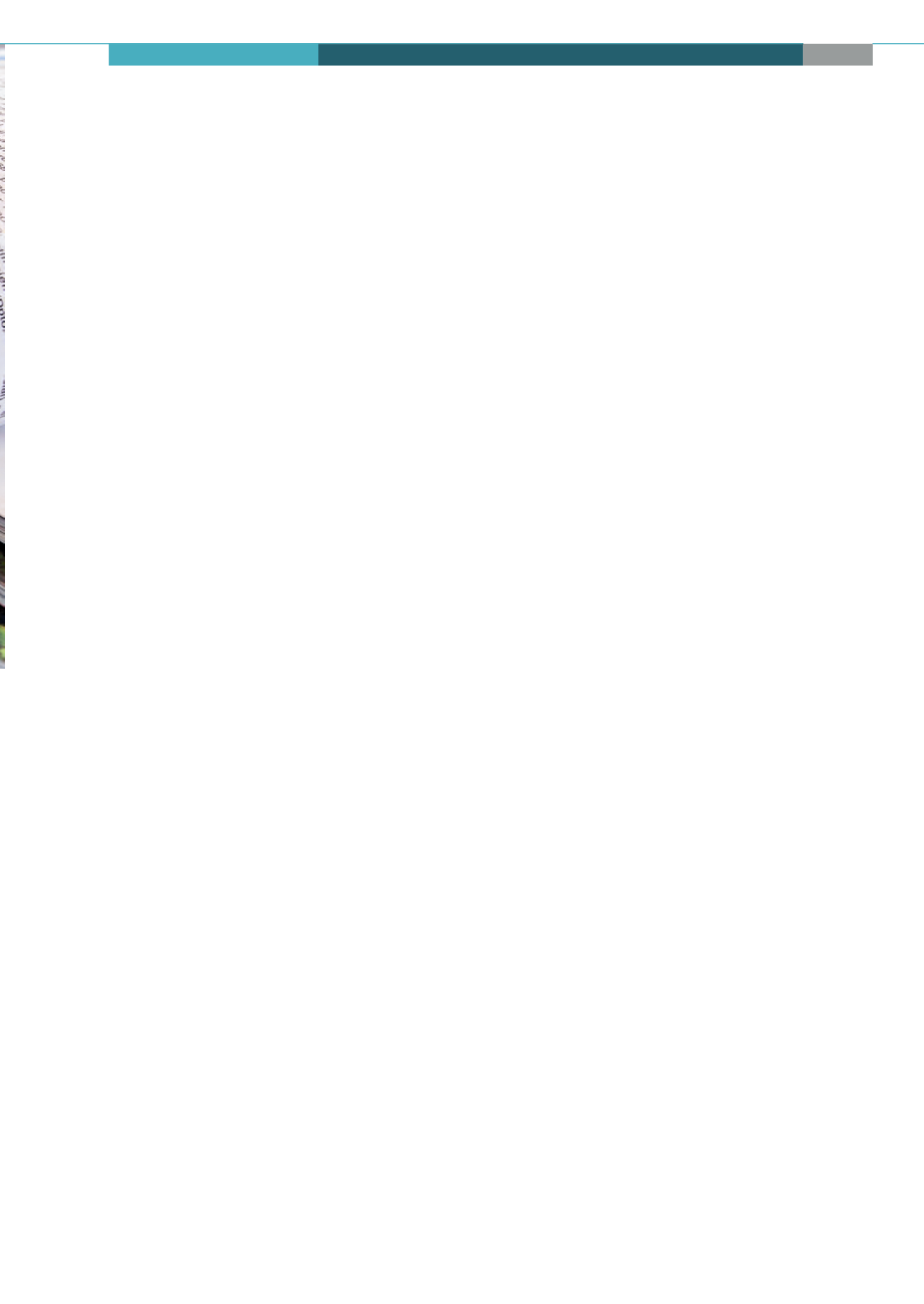
physio
austria
inform
Februar 2014
27
PUBLIKATIONEN
Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Erwin Scherfer, Physio-Akademie des ZVK
Registrierung klinischer Studien
Die Registrierung klinischer Studien bedeutet, dass deren
Studienprotokolle in einer gebührenfreien, öffentlich zu-
gänglichen und elektronisch durchsuchbaren Datenbank,
einem Register, gelistet werden. Die Registrierung wird als
prospektiv betrachtet, wenn das Studienprotokoll gelistet
wurde, bevor die Studie begann (d.h. bevor der erste
Proband in die Studie aufgenommen wurde). Prospektive
Registrierung hat mehrere potenzielle Vorteile. Sie könnte
unnötige Duplizierung von Studien vermeiden, und sie
könnte Menschen mit Gesundheitsproblemen ermögli-
chen, Studien zu finden, in denen sie als ProbandInnen
teilnehmen könnten. Aber vielleicht ist es noch wichtiger,
dass prospektive Registrierung zwei Probleme der klini-
schen Forschung angeht: Selektive Berichterstattung
und Publikationsbias.
Selektive Berichterstattung meint, dass ForscherInnen
nur die »günstig ausgefallenen« Ergebnisse anstatt die
Resultate aller gemessenen Outcomes berichten, wenn
sie ihre Studie veröffentlichen. Wenn aber nur die günstig
ausgefallenen Ergebnisse berichtet werden, so kann das
zu einem irreführenden Eindruck hinsichtlich der Effekte
einer Therapie in der veröffentlichten Literatur führen.
Stellen wir uns zum Beispiel vor, eine völlig ineffektive
Intervention würde in verschiedenen Studien getestet,
und jede Studie würde eine Reihe von Outcomes messen.
Dann würde sich auf den meisten Outcomes kein Effekt
dieser Intervention abbilden. Aber gelegentlich würde sich
doch aus Zufall auf einem Outcome ein signifikanter Effekt
oder eine signifikante Schädigung abzeichnen. Wenn nun
die ForscherInnen die positiven Outcomes veröffentlichen,
aber nicht alle nicht-signifikanten oder negativen Out-
comes, könnten die LeserInnen den falschen Eindruck
gewinnen, dass die Intervention nützlich sei. Ein ähnliches
Problem kann auftreten, wenn Outcomes zu multiplen
Messzeitpunkten gemessen werden. Dann kann es auf-
treten, dass ForscherInnen veröffentlichen, dass eine
bestimmte Intervention die Gehgeschwindigkeit nach
sechs Monaten erhöht hat, aber nicht erwähnen, dass die
Gehgeschwindigkeit nach 1, 2, 3, 9, 12 und 24 Monaten
nicht verbessert war.
Die prospektive Registrierung klinischer Studien bekämpft
dieses Problem auf verschiedene Weisen. So können He-
rausgeberInnen von Fachzeitschriften und ReviewerInnen
vergleichen, ob über die Outcomes, die im registrierten
Studienprotokoll aufgeführt sind, auch in der Veröffentli-
chung berichtet wird, und ggf. auf Auflösung von Diskre-
panzen hinwirken. Und auch LeserInnen können die im
Register klinischer Studien aufgeführten Outcomes
vergleichen mit denen, über die in der Veröffentlichung
Ergebnisse berichtet werden, und mehr Vertrauen den
Studien schenken, die sich hierbei als in sich konsistent
erweisen.
Publikationsbias entsteht, wenn Studien mit positiven
Ergebnissen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, ver-
öffentlicht zu werden als solche mit nicht-signifikanten
Ergebnissen. Wie selektive Berichterstattung kann dies
den Effekt, wie er sich durch die veröffentlichten Daten
darstellt, künstlich aufblähen. So kann zum Beispiel eine
Studie, in der die Intervention effektiv erschien, veröffent-
licht werden, während drei weitere, in denen die gleiche
Intervention ineffektiv oder schädigend erschien, in den
Aktenordnern der ForscherInnen vergilben. Wenn eine
Studie registriert wurde, aber niemals veröffentlicht
wurde, dann können die AutorInnen eines systematischen
Reviews sie immer noch im Register finden, können
Kontakt zu den AutorInnen aufnehmen, um die unpub-
lizierten Daten im Review mit zu berücksichtigen. Auf
diese Weise kann prospektive Registrierung mit dazu
beitragen, den im Fundus der in den veröffentlichten
physiotherapeutischen Studien verfügbaren Evidenz
anzunehmenden Bias zu begrenzen.
Prospektive klinische Registrierung von Studien fördert
Transparenz (Sim et al 2006) und kann es außerdem be-
trügerischen AutorInnen erschweren, Daten zu fälschen.
Zum Beispiel fordern mittlerweile manche Zeitschriften
routinemäßig individuelle PatientInnendaten zur Über-
prüfung an (Herbert 2008) oder überprüfen Daten bei
Betrugsverdacht (Smith u. Godlee 2005). Die Messungen
sollten tatsächlich in dem Zeitraum durchgeführt worden
sein, der als Datenerhebungszeitraum im registrierten
Studienprotokoll ausgewiesen ist. Da viele Outcomes
elektronisch gemessen und gespeichert und dabei mit
einem elektronischen Datumsstempel versehen werden,
vermehrt und verkompliziert dies den Aufwand, der mit
Datenmanipulationen verbunden ist; vor allem, wenn die
manipulierten Daten der Prüfung durch ein Audit stand-
halten sollen. Ebenso kann es sein, dass ForscherInnen,
denen unliebsame Ergebnisse von einer bestimmten
Subgruppe vorliegen, versucht sind, diese zu eliminieren,
indem im Nachhinein ein zusätzliches Ausschlusskriterium
eingeführt wird. Wenn das Studienprotokoll prospektiv
registriert wurde, dann würde dies aber öffentlich evident
für jeden, der das registrierte Studienprotokoll mit dem
Bericht von der Studie vergleicht.
Wie verbreitet ist die Registrierung klinischer Studien?
Das erste große Register für Studien im Bereich Gesund-
heitsversorgung wurde 1998 eingerichtet (De Angelis et
al 2004). Obwohl bald tausende von Studien registriert
waren, blieb die Mehrzahl der Studien doch unregistriert.
2004 empfahl das Internationale Komitee der Herausge-
ber Medizinischer Fachzeitschriften (International Com-
mittee of Medical Journal Editors, ICMJE) die Registrierung
klinischer Studien. Über die Empfehlung hinaus machten
seine Mitgliedszeitschriften die prospektive Registrierung
zur Voraussetzung für eine Veröffentlichung von Studien,
Empfehlungen der »Internationalen Gesellschaft der
HerausgeberInnen« von Physiotherapie-Zeitschriften.
© israelgd - Fotolia.com