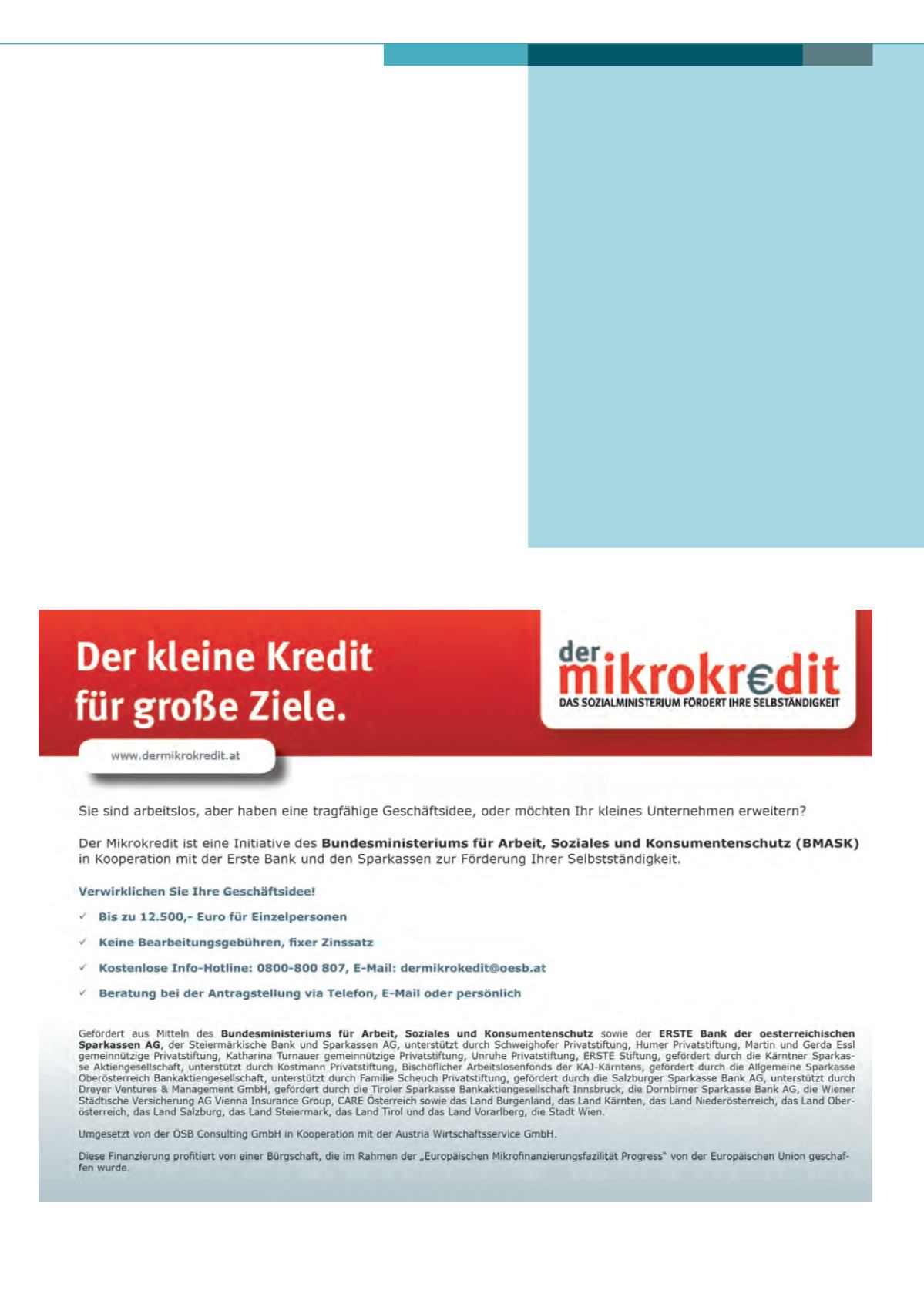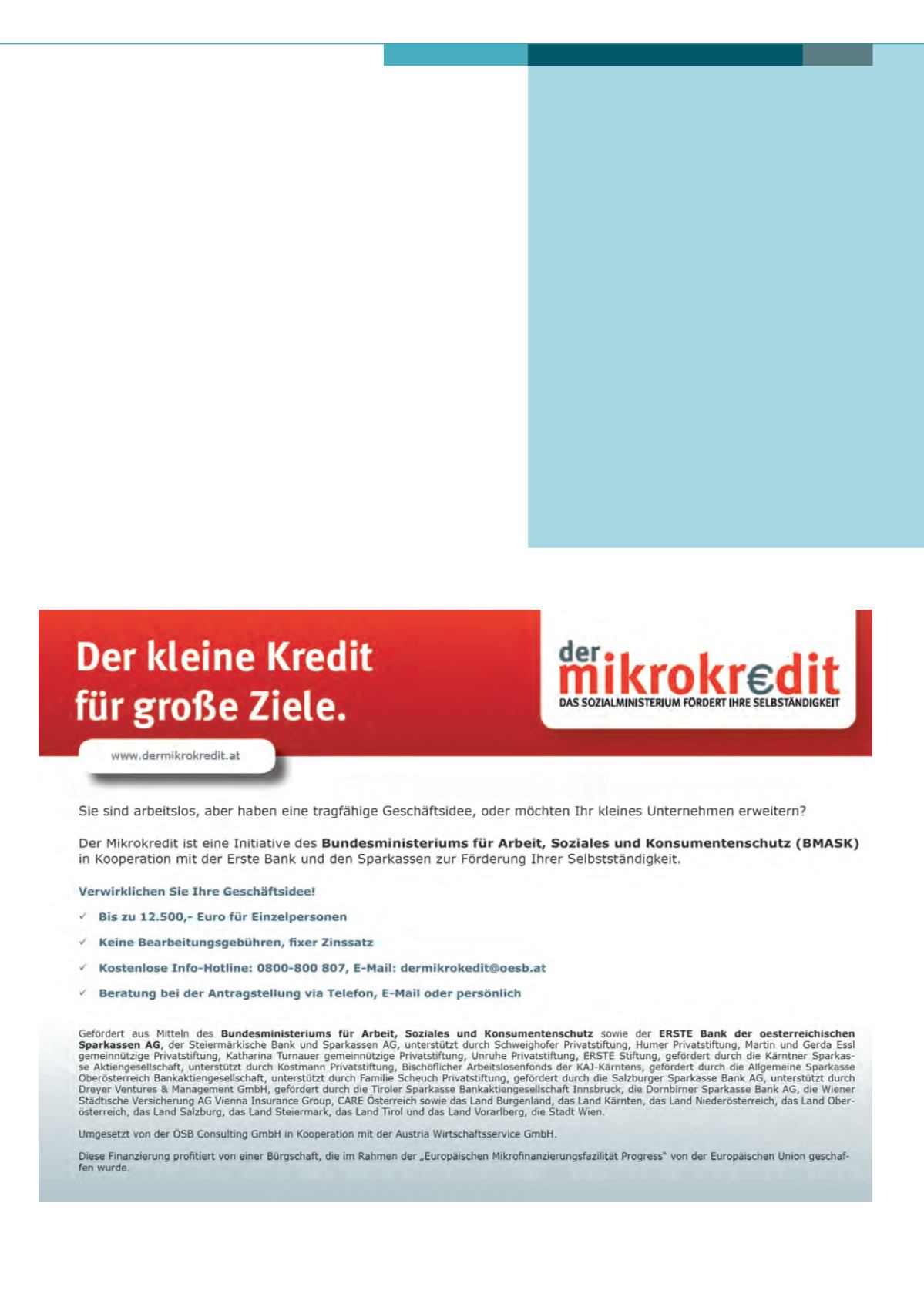
physio
austria
inform
Februar 2014
13
Die Lösung der SGKK die physikalischen Maßnahmen
unter einer Abrechnungsposition zu vereinen ist ein gang-
barer Weg, da die therapeutische Autonomie den Einsatz
gezielt angepasster physikalischer Maßnahmen fördert.
Unnötige Kosten durch derzeit gängige Anwendungen
generalisierter, oft widersinniger physikalischer Kombina-
tionsbehandlungen könnten auf diese Weise reduziert
werden. Dem Low Back Pain als unspezifischer Rücken-
schmerz gebührt aufgrund seiner volkswirtschaftlichen
Bedeutung bekanntlich besondere Aufmerksamkeit. Der
Verzicht auf passive Maßnahmen aufgrund der Chronifizie-
rungsgefahr und die PatientInnenaktivierung als zentrales
Therapieziel sind jedoch in diesem Zusammenhang seit
Jahren schon physiotherapeutischer Usus und finden sich
in den Ausbildungen, sowie entsprechenden Fortbildun-
gen. Einzelne physikalischen Maßnahmen hingegen, die
sich in vielen anderen Fällen vor allem durch sinnvolle
Einbettung in die therapeutische Behandlung durchaus als
zielführend erwiesen haben, aufgrund des momentanen
Mangels an aussagekräftigen und qualitativ angemesse-
nen Forschungsergebnissen aus dem Leistungsangebot
zu streichen, würde jedoch einen Rückschritt unseres
Gesundheitswesens bedeuten. Die Stärkung der Eigen-
verantwortlichkeit und des Bewusstseins für Qualitäts-
sicherung und Gesundheitsökonomie sind im therapeuti-
schen Bereich definitiv nachhaltiger und kosteneffizienter
als die Entwicklung hin zu einer bloßen Evidence forced
Medicine.
Evidenzbasierte Wirtschaftliche
Gesundheitsversorgung
Der Hauptverband der Sozialversicherungs-
träger hat zur Förderung der Evidenzbasierten
Wirtschaftlichen Gesundheitsversorgung eine
Abteilung eingerichtet (Evidence-Based-
Medicine/Health Technology Assessment).
Diese soll Standards erarbeiten und damit
zur höchstmöglichen Versorgungsqualität im
österreichischen Gesundheitswesen bei-
tragen. Laut Selbstbeschreibung integriert
die Abteilung »die bestmöglichen externen
Nachweise aus systematischer Forschung,
die klinische Expertise aus der individuellen
ärztlichen Erfahrung und die Interessen und
Bedürfnisse der Patienten.« Sie berät die
Chefärztlichen Dienste unterstützend, welche
Wechselwirkungen Medikamente beim
Vorliegen einer bestimmten Grunderkrankung
auslösen können oder welche Alternativen
vorhanden sind.
»Neben den Chefärzten sind auch Vertrags-
partnerverhandler, Behandlungsökonomen
und Patientenberater die unmittelbaren
Gesprächspartner.«
Quelle:
bezahlte Anzeige
EVIDENZ
Christian Blatakes