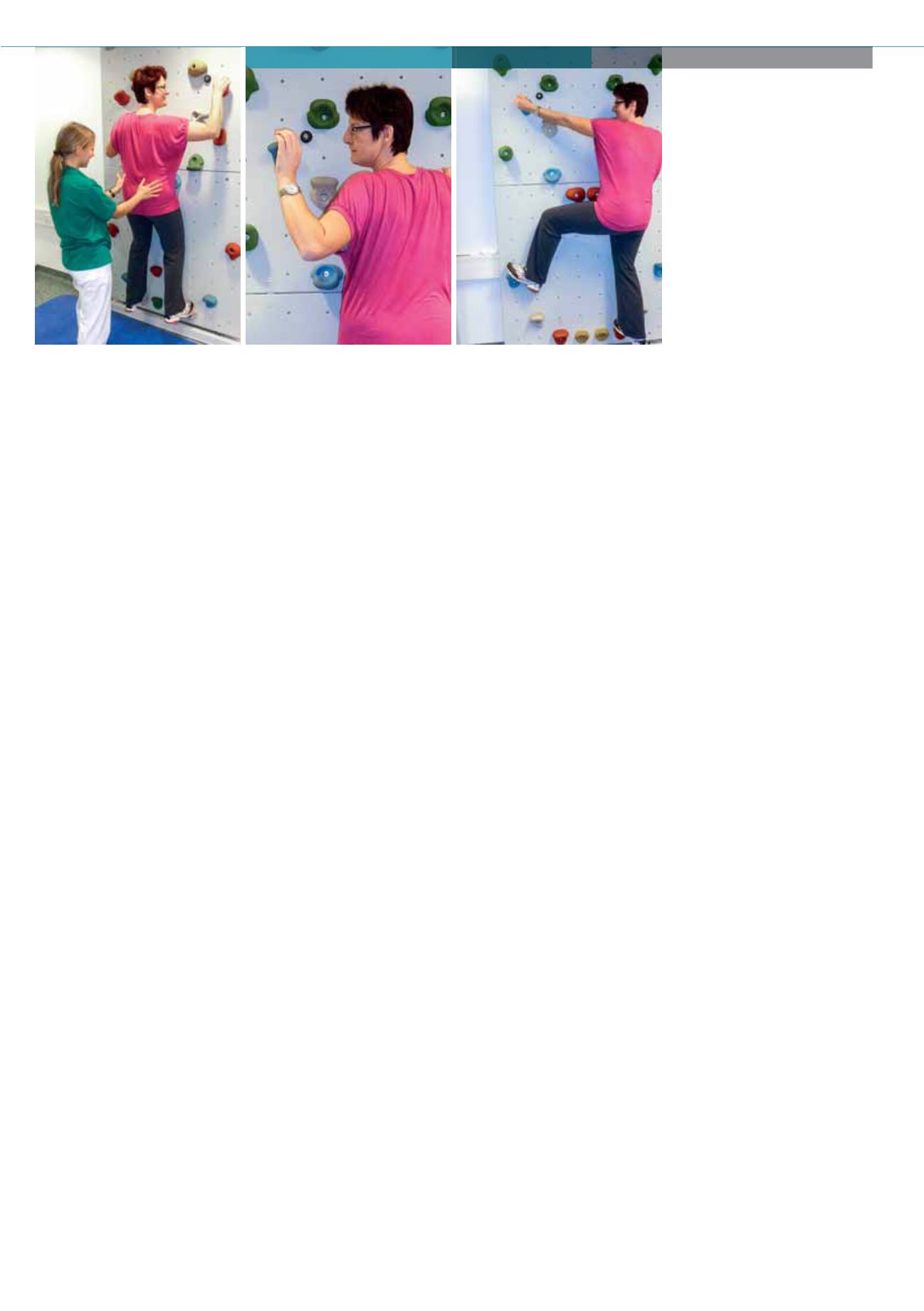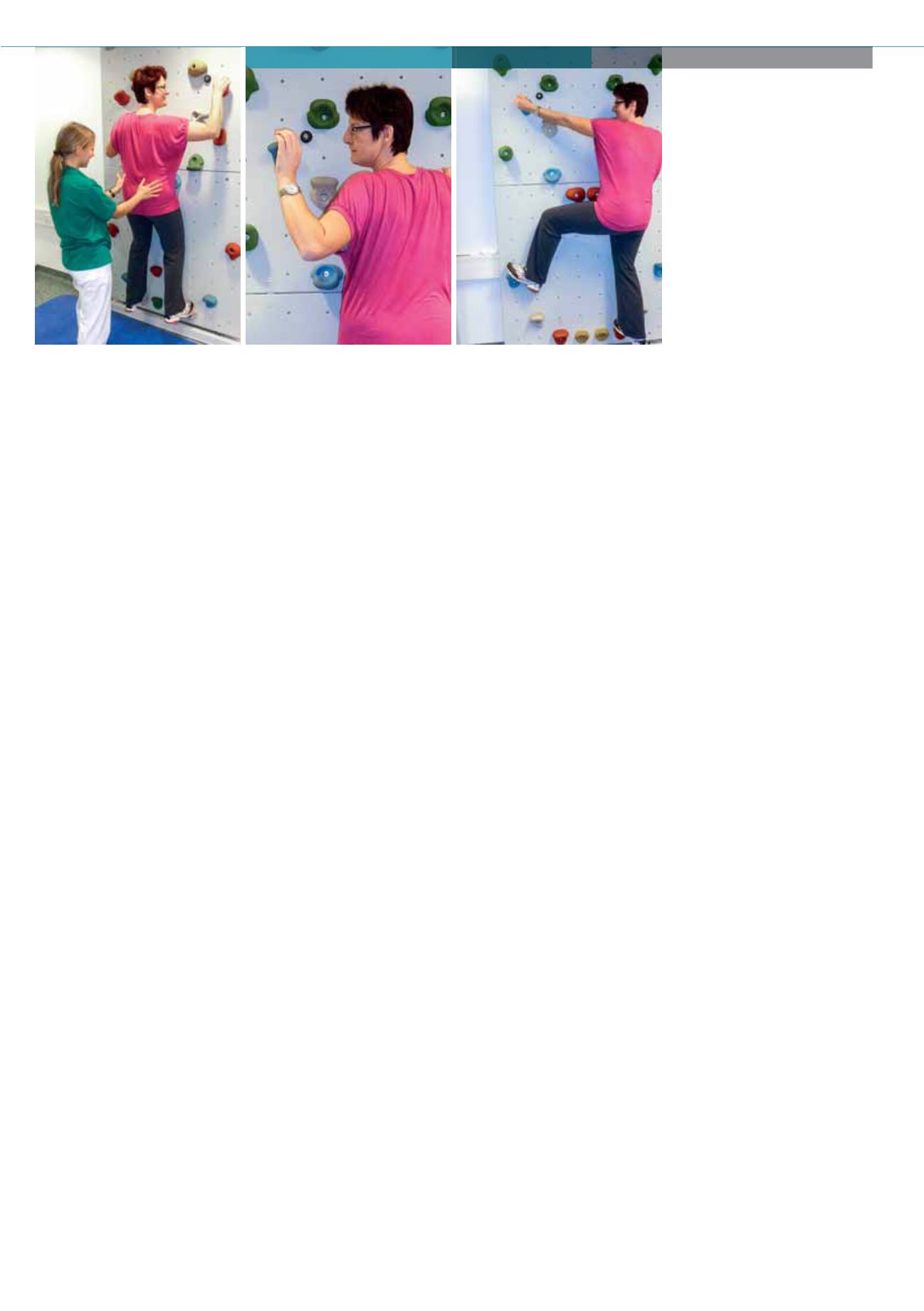
KLETTERN
physio
austria
inform
September 2013
13
Grundposition
Die Grundposition gibt eine optimale Vor-
aktivität: Füße, Knie und Hände haben
Kontakt zur Wand; Sprunggelenke in Null-
stellung; leichte Knieflexion; Schulter nach
unten, korrekte Einordnung der Beinachse;
Becken; Rumpf und Kopf übereinander ein-
geordnet; Arme auf gleicher Höhe. Wichtig
zu wissen ist, dass wenn ein Kontaktpunkt
gelöst wird, ein Drehmoment entsteht. Es
muss als Reaktion entweder der Druck an
den anderen Aufhängen oder Unterstüt-
zungsflächen erhöht werden oder aktiv
widerlagert werden. Gewichte können zur
Widerlagerung durch Halten (Druckerhöhung
an den Griffen, Tritten) oder durch Bremsen
(exzentrisches Nachlassen) oder durch reak-
tives Bewegen (Verlagerung des KSP) unter-
schiedlich eingesetzt werden. Geringe
Veränderungen von Position, Wandneigung
oder Griffauswahl verändern die Anforderun-
gen enorm. Ein Wechselspiel von Spielfunk-
tion, Hängeaktivität und Stützaktivität bringt
Feinabstimmung und Koordination der Kör-
perabschnitte. Wichtig ist die stabile Mitte
(Brustkorb - Becken) als Verbindung zu den
Aufhängen und Stützbereichen. Schon bei
der geringsten Druckveränderung unter
einem Griff oder Tritt werden die schrägen
Muskelketten gefordert.
Der Kreativität beim therapeutischen
Klettern sind keine Grenzen gesetzt, die
Dosierung des Aufwands kann sehr fein
dosiert werden durch:
GRIFFE/TRITTE
Beschaffenheit, Stellung, Größe, Befesti-
gung, Richtung, Entfernung zum KSP
MUSKELARBEIT
exzentrisch, konzentrisch, statisch halten
GLEICHGEWICHT
Reaktionen auf Druckveränderung,
auf Gegengewichte
ZEIT
Wiederholungen, Dauer, Tempo,
WAND
Neigung, Aufhängung
KONTEXT
Höhe, Temperatur, Ablenkung,
Klima, Beziehung
ZUSÄTZLICHE AUFGABEN
blind klettern, barfuß,
Bewegungsaufgaben lösen, uvm.
Wissenschaftlich nachvollziehbare Ergebnisse
für die positive Wirkung des therapeutischen
Kletterns bei MS-PatientInnen sind noch sel-
ten, wie in der Bachelorarbeit »MS on the
rocks - Wie wirkt sich therapeutisches Klet-
tern auf die Rumpfstabilität bei PatientInnen
mit Multipler Sklerose aus?« von Ornetzeder
(2012) beschrieben wird. Eine systematische
Übersicht randomisierter kontrollierter Stu-
dien von Buchter & Fechtelpeter (2011) und
Grzybowski & Eils (2011), geben in deren
Schlussfolgerung an, dass sich die Evidenz
zur Wirksamkeit von Klettern auf kleine Stu-
dien mit erheblichen methodischen Limitatio-
nen beschränkt. Aber durch die zahlreichen
positiven Rückmeldungen der PatientInnen
mit Multipler Sklerose, entwickelt sich das
therapeutische Klettern trotz der begrenzten
wissenschaftlichen Beweislage kontinuierlich
zu einem Bestandteil der Physiotherapie. Die
fehlenden wissenschaftlichen Nachweise soll-
ten deshalb nicht zu einer Ablehnung des the-
rapeutischen Kletterns führen, sondern als
Forschungsanreiz für noch weitere qualitativ
hochwertige Untersuchungen in der neuro-
logischen Rehabilitation gelten.
Auf Grund vieler positiver Eigenschaften und
des vielversprechenden PatietenInnenfeed-
backs ist das therapeutische Klettern in Kom-
bination mit unter anderem Physiotherapie
während eines Rehabilitationsaufenthaltes zu
empfehlen. Es ist ein weiterer Baustein in
einer erfolgreichen Rehabilitation von Patien-
tInnen mit Multipler Sklerose und sollte auf
jeden Fall weiterentwickelt werden.
Astrid Ornetzeder, BSc
©
LITERATUR
Buchter, R. B. & Fechtelpeter, D.,
2011. Climbing for preventing and
treating health problems: a system-
atic review of randomized controlled
trials - Klettern zur Vorbeugung und
Behandlung von Erkrankungn: Eine
systematische Übersicht rando-
misierter kontrollierter Studien.
Institute for Quality and Efficiency
in Health Care (IQWiG), Köln,
German Medical Science.
Fleissner, H. et al., 2010. Thera-
peutisches Klettern verbessert
Selbstständigkeit, Mobilität und
Gleichgewicht bei geriatrischen
Patienten. Landeskrankenhaus Laas,
Kötschach-Mauthen, Eurjoger Vol.
12, European Journal of Geriatrics,
pp. 12-16.
Friedrich, D., 2011. In: Multiple
Sklerose und Sport - Immer in
Bewegung. 1. Auflage Hrsg.
s.l.:TRIAS Verlag, pp. 92-93.
GryzibowskiI, C. & EILS, T., 2011.
Therapeutisches Klettern - kaum
erforscht und dennoch zunehmend
eingesetzt. Institut für Bewegungs-
wissenschaft, WWU Münster, Sport-
verl Sportschad 25 © Georg Thieme
Verlag, pp. 87-92.
Kern, C., 2010. Klettern mit Multiple
Sklerose - Therapieoption oder nur
ein Traum. e&l, praxis, pp. 27-31.
Lamprecht, S., 2008. NeuroReha
bei Multipler Sklerose. s.l.:Georg
Thieme Verlag, Stuttgart.
Lazik, D., Berndstädt, W., Kittel, R. &
Luther, S., 2008. Therapeutisches
Klettern. s.l.:Georg Thieme Verlag,
Stuttgart und Erfahrungsbericht zum
therapeutischen Klettern, Potsdam:
Institut für Sportmedizin und Präven-
tion der Universität Potsdam.
Muhlbauer, T., Sturchler, M. &
Granacher, U., 2012. Effects of Clim-
bing on Core Strength and Mobility
in Adults. Department of Training &
Movement Science, University of
Potsdam and Institute of Exercise
and Health Siences, University of
Basel; Corr.: Friedrich-Schiller-
University Jena, Institute of Sport
Science; Int J Sports Med 33(06) ©
Georg Thieme Verlag, pp. 445-451.
Reimann, G., 2011. Therapeutisches
Klettern bei Multipler Sklerose -
Sichtweise der neurowissenschaftli-
chen Lernforschung und Einbindung
der ICF. pt_Zeitschrift für Physio-
therapeuten, Mai, pp. 60-63.
Steinlin Egli, R., 2011. Multiple
Sklerose - verstehen und behandeln.
s.l.: Springer Verlag Berlin
Heidelberg.